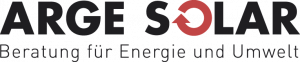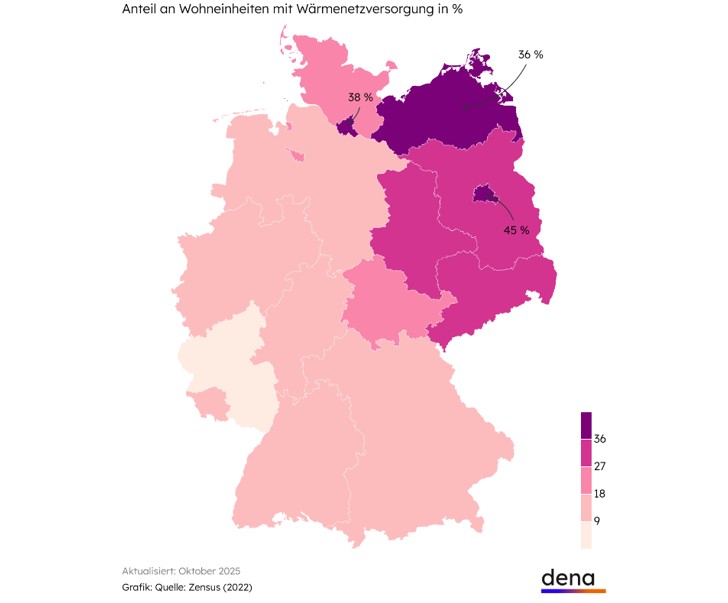Deutsche Energie-Agentur dena veröffentlicht Leitfaden zum Energy-Sharing
Am 28.04.2025 hat die Deutsche Energie-Agentur dena einen Leitfaden veröffentlicht, der sich mit der Umsetzung von Konzepten des Energy-Sharing in Deutschland befasst, insbesondere mit der Umsetzung von sog. Energy Sharing Communities (ESC). Maßgeblich waren dafür die Erkenntnisse und Praxiserfahrungen aus der Energy Sharing Community „WUNergy“ in Wunsiedel.
Eine Energiegemeinschaft (EG) – auch Energy-Sharing Community (ESC) – ist eine Vereinigung mehrerer Beteiligter, die gemeinsam Energie produzieren, speichern, nutzen oder verkaufen. Diese Zusammenarbeit erfolgt über Grundstücksgrenzen hinweg – die Energie kann also flexibel innerhalb einer bestimmten Region oder sogar darüber hinaus verteilt werden. Eine Erneuerbare-Energie-Gemeinschaft (EEG) funktioniert nach demselben Prinzip, nutz jedoch nur erneuerbare Quellen zur Erzeugung der eigenen Energie.
In dem Leitfaden wird anhand von vier Phasen erläutert, welche Hürden auf dem Weg zur Gründung und dem Betrieb einer Energiegemeinschaft maßgeblich sind. Der Leitfaden gliedert sich wie folgt:
- Initialisierungsphase
In dieser Phase sollen sich die Initiatorinnen und Initiatoren mit den Rahmenbedingungen einer Energiegemeinschaft vertraut machen und Erwartungen an das Projekt / Ziele des Projektes genau definieren. - Gründungsphase
Wenn die Initialisierungsphase abgeschlossen ist, kann eine Rechtsperson gegründet werden, um die notwendige Struktur einer Energy Sharing Community zu schaffen. Außerdem werden zu diesem Zeitpunkt die Geschäfts- und Tarifmodelle erstellt. Der dena-Leitfaden geht auf verschiedene Möglichkeiten gültiger Rechtsfiguren ein. - Realisierungsphase
Die Realisierungsphase befasst sich mit der tatsächlichen Umsetzung des in der Gründungsphase entwickelten Konzeptes. Zur Realisation müssen beispielsweise entsprechende Verträge aufgesetzt und geschlossen werden, notwendige Technologie muss angeschafft und ausgestattet werden. - Laufender Betrieb
Im letzten Bereich des Leitfadens geht es insbesondere um die Herausforderungen, die beim Betrieb einer solchen Energy Sharing Community auftreten können. So fragt der Leitfaden beispielsweise nach Möglichkeiten zur effizienten Verwaltung von Erzeugungs- und Verbrauchsdaten der Mitglieder, oder nach einer zielführenden Weiterentwicklung bestehender Konzepte.
Dabei werden in dem Leitfaden zentrale Begriffe und Konzepte erklärt und praktische Beispiele gegeben. Beispielsweise wird auf die verschiedenen Modelle eingegangen, nach denen eine Energy Sharing Community gebildet und betrieben werden kann:
Modell 1: Vollversorgungsmodell mit einem zentralen Energieversorger
Dieses Modell basiert auf einem zentralen Energieversorger, der alle Mitglieder der ESC beliefert. Mitglieder, die selbst Strom erzeugen, geben ihren überschüssigen Strom an den zentralen Anbieter ab, der dann alle Verbraucher innerhalb der Gemeinschaft versorgt. Die Abrechnung erfolgt zentral durch den Versorger, der auch den Reststrom bereitstellt, falls die Erzeugung nicht ausreicht. Dieses Modell ist bereits rechtlich umsetzbar und bietet eine klare, zentrale Steuerung, was die Organisation vereinfacht.
Modell 2: Mehrlieferantenmodell mit virtuellen Peer-to-Peer-Lieferungen
Hier wählen die Mitglieder eigene Lieferanten, die ihren Strom an die jeweiligen Verbraucher liefern. Die Kommunikation und Datenübertragung erfolgen über eine Sharing-Plattform, wodurch eine flexible und dezentrale Struktur ermöglicht wird. Allerdings ist die direkte Peer-to-Peer-Lieferung im rechtlichen Rahmen derzeit noch sehr eingeschränkt, sodass die Energiegemeinschaft meist als Vermittler oder Händler auftritt. Dieses Modell bietet mehr Möglichkeiten zur Individualisierung, ist aber komplexer in der Umsetzung.
Modell 3: Direktlieferungsmodell / Lieferbeziehungen zw. Mitgliedern
Dieses Modell setzt auf direkte Stromlieferungen zwischen den Mitgliedern, ohne einen zentralen Versorger. Über eine digitale Plattform können Angebot und Nachfrage automatisiert abgewickelt werden. Es handelt sich hierbei um eine sehr dezentrale Lösung, die im europäischen Kontext bereits in Pilotprojekten getestet wird. In Deutschland ist diese Form der direkten Peer-to-Peer-Lieferung derzeit rechtlich noch nicht möglich.
Neben dem „Leitfaden zur Umsetzung von Energy Sharing Communities in Deutschland“ hat die Deutsche Energie-Agentur auch den Praxisbericht „WUNergy eG: Aufbau einer Energy Sharing Community in Wunsiedel“ veröffentlicht. Dort finden Sie tiefergehende Informationen zu der Energy Sharing Community „WUNergy“.
Außerdem finden Sie zahlreiche weitere Informationen und Materialien rund um das Thema Energy Sharing in unserem „Energiespar-Wiki“ der Landeskampagne „Energieberatung Saar“.